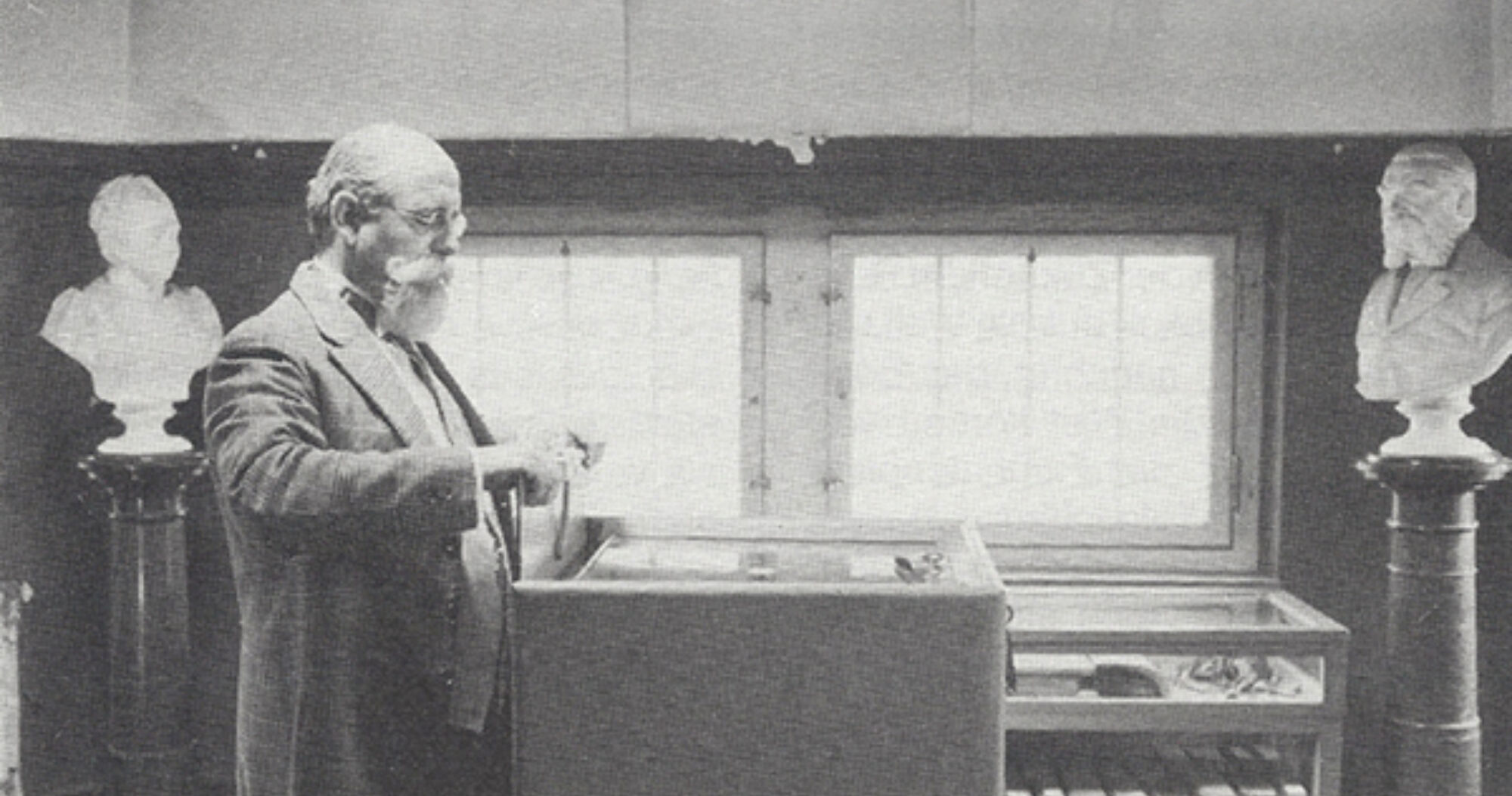«Das grosse Mitte-Land» war der Arbeitstitel des Films. Jetzt heisst er Babylon II. Diese Verschiebung ist nicht nur wörtlich bezeichnend, sie greift auch tiefer in die vermittelnde Struktur dieser ungewöhnlichen Montage ein. Dabei ist die grosse Sprachverwirrung nur ein Aspekt des ganzen Kaleidoskops. Samirs facettenreicher Dokumentarfilm bedient sich der Möglichkeiten des computergesützten Materialschnitts, der es erlaubt, die Bilder mehr denn je nicht nur aneinander, sondern auch übereinander und ineinander zu montieren.
Lebensform Exil
Es geht um die Situation der «Ausländer im Inland», um Menschen, die in der Schweiz leben, ohne als Schweizerinnen oder Schweizer geboren zu sein. Aber nicht nur wie sie leben, sondern auch wo sie leben und warum sie da leben, gehört zu den vielen Fragen, die Samir sich, ihnen und damit indirekt seinem Publikum stellt. Direkte Fragen führen nur dort zum Ziel, wo ein Ziel vorhanden ist. Und klare Antworten lenken oft von anderen Umständen ab, indem sie so etwas wie Zustände festschreiben. Das ist eines der grossen Probleme des klassischen Dokumentarfilmes: Die Wirklichkeit lässt sich nur interpretierend vermitteln, und je einfacher sie vermittelt wird, desto einfacher wird das Bild von ihr – das ist im schlimmsten Fall dann so, dass jemand auf ein paar gefundene klare Antworten nachträglich die passenden Fragen zu formulieren sucht.
Zurück zu den Anfängen
Eine der ersten Arbeiten von Samir war eine autobiographische Videocollage mit dem angsteinflössenden Titel Semiotik einer Heimat (1984). Samir, der als Sechsjähriger mit seinen Eltern aus dem Irak in die Schweiz gekommen war und hier aufgewachsen ist, versuchte zu ergründen, was «Heimat» jenen bedeuten könnte, denen ihre Selbstverständlichkeit abhanden gekommen ist.
Damals konfrontierte er Freunde und Bekannte mit der Frage nach «Heimat», und einzelne Szenen aus jenem Video haben im neuen Film Eingang gefunden. Die direkte Gegenüberstellung von zehn Jahre alten Szenen mit dem neuen Material ist nicht nur amüsant, sie hilft auch, dem oft als protokollarisch kühl empfundenen Videoauge so etwas wie nachsichtigen Humor abzugewinnen.
Dass die Fragen die gleichen bleiben, auch wenn sich die Menschen verändern, ist eine ebenso triviale wie für den Dokumentarfilm grundlegende Feststellung.
Jetzt, da die Welt heftiger denn je in Bewegung geraten ist, wo Menschen sich vor anderen Menschen zu fürchten beginnen, nur weil diese nicht dort bleiben wollen oder gar können, wo sie sind, werden wieder die heiseren Stimmen mit den klaren Antworten laut, jene, die wissen, was Heimat ist und wem sie gehört.

Polyperspektive
Samir, der sich in fast all seinen Arbeiten mit medialen Mischformen und vor allem den Möglichkeiten der mehrfachen Bildermontage auseinandergesetzt hat, hat versucht, schon die Konzeption des geplanten Dokumentarfilmes auf seine vom AVID Computer-Schnittsystem erweiterten und vereinfachten Montagemöglichkeiten hin einzurichten.
Drei Themenblöcke gehen das eigentliche Thema des globalen Exils unter verschiedenen Aspekten an, und für jeden wurden wiederum eigene filmische Darstellungen entwickelt.
Suburbs, Emigration und Massenmedien werden in einen direkten Zusammenhang gestellt, sie werden bildlich zusammenmontiert und geben damit wiederum ein (gebrochenes) Bild von Zusammenhängen, die ebenso real wie eindeutig konstruiert sind.
Auf der einfachsten interpretatorischen Ebene geht Samir davon aus, dass die mehr oder weniger gesichtslosen mittelländischen Vorstädte vor allem auch jene beherbergen, denen so etwas wie die «ursprüngliche Heimat» abhanden gekommen ist, seien es nun die «Ausländer» oder auch die «inneren Emigranten», Zuzüger aus anderen Gebieten.
Eine Identifikation mit dem Wohnort ist nicht mehr so einfach, wenn dieser austauschbar geworden ist, und das gleiche lässt sich auf die eigene Persönlichkeit übertragen.
Identifikationsmedien
Hier lokalisiert Samir eine Funktion der Massenmedien. Sie, die sich der totalen Vermittlung verschrieben haben, übernehmen zwangsläufig auch identifikatorische Aufgaben.
Ob sich das darin äussert, dass vom Balkon des Wohnblocks eine Satellitenschüssel türkische Fussballspiele ins Land holt, ob eine junge Frau Anregungen für ihre persönlichen Ausdrucksbemühungen von Kino und Fernsehen bezieht, oder ob sich ein Mann gar selbst als Vermittler zwischen den Welten in den Dienst eines Mediums stellt: Für die Medienkonsumenten erfüllen diese eine zugleich individuelle und integrierende Funktion.
Das Medium wäre das Medium. Die Vermittlung wäre seine Aufgabe. Aber die Vorstellung, dass ein Massen-Medium zwischen Massen zu vermitteln vermöchte, erscheint nachgerade absurd. Also muss die Vermittlung vom monströsen Massenbegriff absehen, eine Individualisierung versuchen, zerlegen, aufteilen, anbieten.

Fragmentarische Wahrnehmung
Das kann so geschehen, wie es die Soap-Operas und das Unterhaltungskino vormachen, über ein stereotypes Angebot an Identifikationsschablonen – oder aber über das Eingeständnis, dass fragmentarisch gesammelte und angebotene Aspekte der tatsächlichen Wahrnehmung der Welt gerechter werden. Samirs neuer Film versucht diese zweite, echte Form der Vermittlung.
Den Kern bilden Aussagen von Frauen und Männern zu ihrer persönlichen Situation, ihren Hoffnungen, ihrer Herkunft, ihrem Selbstverständnis. Diese Szenen sind mit einer Videokamera in einer Interviewsitua tion entstanden, die Bild-im-Bild Montage vermittelt dabei über die Sätze der Menschen hinaus einen Eindruck von der Gesprächssituation an sich. Subjektiv erscheint Samirs alter ego als Gegenüber, als überaus diskreter Interviewer, als Ansprechpartner.
Fenster mit Einsicht
Während die Basler Rapperin Luana, MC Carlos von der Westchweizer Gruppe Sens Unik», Sahin Ersan vom EHC Bülach und andere in einem «Bildfenster» sprechen, ergänzt der Bildhintergrund die Szenen, fügt bei, stört auch manchmal und sorgt damit für den ständigen Hinweis, dass hier etwas medial vermittelt wird, dass gezielte Bilder willkürliche Eindrücke erzeugen.
Dazu kommen alte Videoaufnahmen, die zugleich an frühere, ähnliche Vorgänge erinnern und diese zusammen mit den neuen relativieren.
Gestellte, wunderbar kitschigintensive Spielbilder (gedreht auf Super 16) übernehmen die thematische Gliederung des ganzen Films. Sie sind szenische Aufarbeitungen ganzer Ideenkomplexe. So steht zum Beispiel ein kleiner Junge fasziniert in einem Regen aus Eiswürfeln. Die Szene geht zurück auf eine Jugenderinnerung des Autors: Als seine Mutter in Bagdad vom Schnee in der Schweiz erzählte, stellte sich der kleine Samir fallende Eisbrocken vor, weil seine arabische Sprache zwischen Schnee und Eis gar nicht zu unterscheiden brauchte.
Ausschnitte aus Spielfilmen dienen als kontrastierende Klischee-Bündel, und alte Wochenschauen sowie ein temporeicher, gebrochener Einschub-Essay über das «grosse Mitte-Land » von Suburbia vermitteln ihrerseits Eindrücke von dem, was sich hier in der Schweiz mit den Hoffnungen, Klischees und Vorstellungen in den Köpfen der Einwanderer zu verbinden trachtete.
Deklarierte Perspektiven
All diese Bildebenen werden auch als Ebenen dargestellt. Sie überlagern sich als Hintergrund und Vordergrund, sie ergänzen, bestätigen, konterkarieren oder widersprechen sich.
Viele der über- und unterlagerten Bilder werden zusätzlich durch Schrifttitel über- oder unterlegt, die einmal mehr durch die Hervorhebung bestimmter Aussagen den Eindruck der Subjektivierung verstärken. Einzig die in Super 16 gedrehten Spielszenen stehen ganz für sich allein und bekommen dadurch eine unwirkliche, magische Ausstrahlung, die rührt, verblüfft, oder, im Falle eines extrem subjektiv gefilmten Skinhead-Angriffs, enorm erschreckt.
Samir ist es mit Babylon II gelungen, die poly-perspektivischen Elemente seiner früheren experimentellen Arbeiten auf verblüffende Weise für den Dokumentarfilm fruchtbar zu machen. Die sich ergänzenden, überlagernden, manchmal überfordernden, und hin und wieder gar kindlich beglückenden oder ebenso erschreckenden Bilder hinterlassen eine Vielfalt von Eindrücken, die mit unseren alltäglichen Wahrnehmungsgewohnheiten korrespondieren. Aber nicht, indem sie clip-mässig einen schnellen Oberflächenreiz erzeugen, sondern über ein diszipliniertes Angebot an deklarierten Perspektiven.