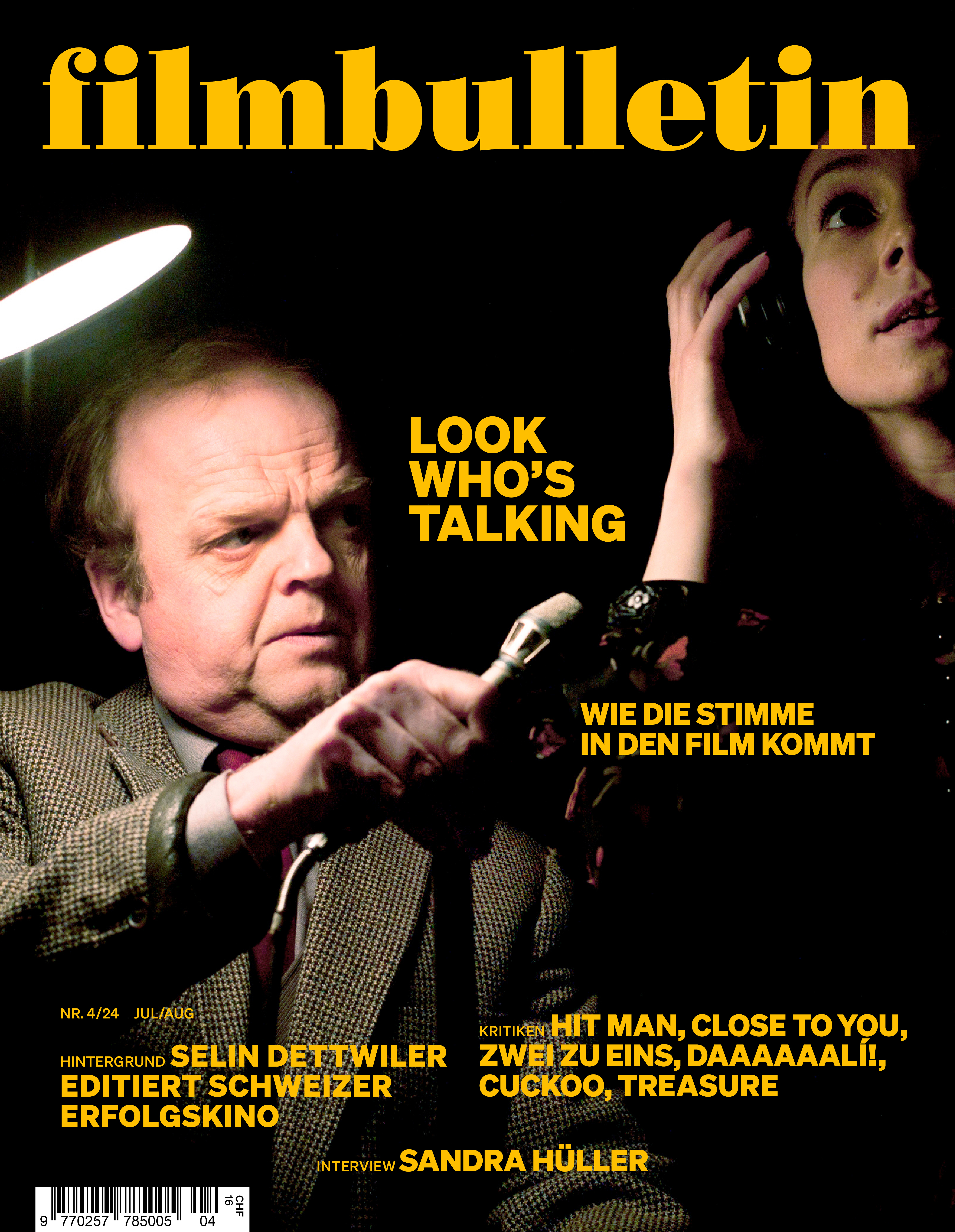FB Frau Hüller, Sie haben mit Ihren beiden letzten Filmen – Anatomie d’une chute von Justine Triet und Jonathan Glazers The Zone of Interest – einen bemerkenswerten Karriereschub erfahren. Die Medien betonen gerne, wie natürlich und uneitel Sie bei dem ganzen Star-Buzz geblieben sind. Wie
empfinden Sie das?
SH Ich weiss nicht so richtig, was das heisst. Ich nehme schon wahr, ob ich an einem Tag irgendwie okay aussehe oder nicht so. Das kriege ich schon mit. Aber ich finde, Schauspiel hat nichts mit Schönheit zu tun.
FB Sind Sie jemand, der gut mit Kritik umgehen kann?
SH Ich umgebe mich zumindest mit Leuten, die – ich glaube, ich hoffe – immer ehrlich mit mir sind.
FB Ist die Schauspielerei ein Beruf, den Sie jungen Menschen heute noch empfehlen würden?
SH Man muss Schauspielerin sein oder nicht. Ich kann dem weder zusprechen noch davon abraten. Wenn man das Gefühl hat, man muss das machen, dann muss man es auf sich nehmen. Es ist heute sicherlich in vielerlei Hinsicht leichter, weil bestimmte Grenzen anders gesetzt sind, schon gesellschaftlich, was sexistische Verhaltensweisen angeht. Die Art und Weise, wie man offen über das Thema sprechen kann, ist heute anders. Insofern ist da wirklich schon viel passiert.
«Ich finde, Schauspiel hat nichts mit Schönheit zu tun.»
FB Haben Ihre Eltern Ihre Entscheidung, Schauspielerin zu werden, unterstützt?
SH Mit Vorbehalt. Sie haben sich ein bisschen gefürchtet, haben aber auch gemerkt, dass es mir sehr wichtig ist.
FB Hatten Sie einen Plan B?
SH Ja, ich wäre Hebamme geworden.
FB Gab es einen Schlüsselmoment, eine bestimmte Rolle, bei der Sie gemerkt haben, dass die Schauspielerei das ist, was Sie machen wollen?
SH Das erste Stück, was wir im Schultheater aufgeführt haben, war «Frühlings Erwachen» von Frank Wedekind. Man hatte mir den Rektor Sonnenstich zugeteilt. Ich habe einen Anzug von meinem Vater dafür angezogen. Die Verwandlung, das Spielen hat mir unheimlich Spass gemacht. Ich bin zwar davon ausgegangen, dass das nicht immer so sein wird, aber ich habe gemerkt, dass es mir Freude bereitet, auf der Bühne zu stehen, mehr als andere Sachen. Insofern war das wahrscheinlich die erste Begegnung damit.
FB Wie schauen Sie im Nachhinein auf den Oscar-Trubel zurück?
SH Es war eine sehr interessante Erfahrung.
FB Hat der berufliche Erfolg Sie auch persönlich verändert?
SH Das finde ich jetzt gerade heraus. Viel mehr sagen kann ich dazu noch nicht. Aber ich bin froh, dass es mir jetzt passiert, und eben nicht ganz jung. Das merke ich schon, weil das jetzt und hier mein Leben ist. Ich habe es mir so gestaltet, wie ich es haben will. Es ist nicht so, dass ich auf irgendwas gewartet hätte. Und mir ist durchaus bewusst, dass alle Dinge irgendwann vorbeigehen. Deswegen kann ich, was jetzt passiert, annehmen und geniessen.
FB Ihr neuer Film Zwei zu eins spielt im Jahr 1990 in Halberstadt. Sie sind selbst auch in Ostdeutschland aufgewachsen, als die Mauer fiel, waren Sie elf Jahre alt. Wie haben Sie die Wendezeit persönlich erlebt?
SH Das kann ich ganz schwer beantworten. Es ist mir nahezu unmöglich, heute über diese Zeit zu sprechen, weil es in erster Linie Kindheitserinnerungen sind, die gar nichts mit einem erwachsenen Blick zu tun haben. Ich verbinde mit der Zeit hauptsächlich private Bilder, die ich sehr wertschätze und die ich mir als solche bewahren möchte.
FB Der Film ist von wahren Begebenheiten inspiriert. Tatsächlich wurden damals insgesamt fast 400 Tonnen an DDR-Geldscheinen in einem alten Stollen entsorgt, aus dem schliesslich Geld entwendet wurde. Wie haben Sie davon erfahren?
Sh Über das Drehbuch. Es klingt natürlich erst mal verrückt, aber andererseits: Wie funktioniert das, wenn plötzlich eine Währung von der Landkarte verschwindet? Was macht man damit? Wir haben viel darüber nachgedacht, ob das nur für die DDR-Mark galt. Oder ob für alle Währungen derartige Entsorgungspläne bestehen. Im Grunde ist es ja nichts Weiteres als bedrucktes Papier.
«Ich habe es mir so gestaltet, wie ich es haben will.»

© Peter Hartwig, X Verleih AG
FB Bedrucktes Papier, das dem Staat gehört, also eigentlich allen, dem Volk. Und der Film stellt die Frage: Darf man es deshalb behalten und nutzen? Was hätten Sie in der Situation getan?
SH Ich weiss nicht, ob ich, wie diese Hausgemeinschaft, jemals auf die Idee mit dem Tauschtrick gekommen wäre. Das war schon sehr speziell. Aber grundsätzlich finde ich die Vorstellung, das Geld unter den Menschen aufzuteilen, richtig und gut.
FB Gibt es trotzdem auch einen persönlichen Wunsch, den Sie sich mit einem Vermögen in dieser Grössenordnung verwirklichen würden?
SH Ich glaube, dass das wahnsinnig unbefriedigend ist, wenn man so viel Geld für sich ausgibt. Das ist vor allem so endlich. Ich glaube, dass es viel toller ist, wenn man das aufteilt. Wie diese Millionenerbin, Marlene Engelhorn. Wenn man damit Gesellschaftsprojekten hilft, die der eigenen Überzeugung entsprechen.
FB Neben der Rahmenhandlung steht Ihre Figur, Maren, im Mittelpunkt einer komplizierten Dreiecksgeschichte. Einer der beiden Männer, die sie liebt, ist kurz vor dem Fall der Mauer heimlich über Ungarn in den Westen abgehauen. Wäre Maren mitgegangen, wenn Volker sie gefragt hätte?
SH Das kann schon sein. Aber darüber habe ich in dem Moment nicht nachgedacht.
FB Was hat Sie an der Figur interessiert?
SH Ihre Grundeigenschaften: Die Stabilität und die Warmherzigkeit, die sie ausstrahlt. Dazu ihr Witz und ihre Unerschrockenheit, all das.
FB Glauben Sie, dass die DDR noch länger existiert hätte, wenn man den Menschen erlaubt hätte, in den Westen zu reisen?
SH Das Misstrauen in die Freiwilligkeit war sicherlich ein Fehler. Viele Menschen hätten sich vielleicht sogar von sich aus dafür entschieden, in der DDR zu bleiben, einfach weil sie es für das bessere System hielten. Kann schon sein. Und sozusagen der Verdacht, dass die Verführungen – oder wie auch immer man das nennen möchte – des Westens so gross gewesen wären, dass dann keiner mehr zurückgekommen wäre, darin liegt das Kernproblem. Denn das zeigt ja das Misstrauen in die eigene politische Idee.
«Ich bin immer vorsichtig mit so einem Bashing von allem Neuen.»

© Peter Hartwig, X Verleih AG
FB Zusammenhalt, Gerechtigkeit, Freundschaft sind Werte, die im Film angesprochen werden. Aber wenn man sich heute umschaut, sieht die Realität ganz anders aus. Wie gehen Sie damit um?
SH Ich beobachte das auch. Und ich nehme auch wahr, dass der Austausch untereinander weniger wird, weil er nur noch über die sozialen Medien stattfindet. Ich bin immer vorsichtig mit so einem Bashing von allem Neuen, weil ich denke, meine Grosseltern fanden auch nicht gut, was wir gemacht haben. Vielleicht entsteht daraus auch etwas Positives, was wir noch gar nicht erkennen oder begreifen können. Oder vielleicht ist es nur etwas, das uns nicht richtig liegt. Ich weiss es nicht so genau. Es ist mir nur unangenehm, dass das so ist.
FB Worin besteht die Gefahr?
SH Dass die gesellschaftlichen Verschiebungen, die wir gerade erleben, auch damit zu tun haben, dass es untereinander dieses Korrektiv irgendwie nicht mehr gibt. Dass zum Beispiel der eine Nachbar oder die Nachbarin nicht mehr zum anderen sagen kann: «Was redest du für einen Stuss?» Weil wir nicht mehr miteinander sprechen, sondern weil es Leute sind von überall, die irgendwo ihr Häkchen drunter setzen. Diese Anonymität ist sicherlich gefährlich, gerade in dieser Situation.
FB Denken Sie, dass den Menschen im Osten dieses Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit besonders fehlt? Dass sie sich tatsächlich abgehängt fühlen, wie es immer heisst?
SH Ich denke, dass die Wende nicht richtig verarbeitet worden ist. Es ging einfach zu schnell. Und ich nenne das jetzt einfach mal ein «Trauma», das dadurch entstanden ist. Dieses Trauma ist bei vielen Mitgliedern in der Gesellschaft einfach nicht behandelt worden, und da passiert auch nichts mehr, weil die Sache offiziell abgeschlossen ist. Ich habe kein Verständnis für faschistische, rassistische Wahlentscheidungen. Null. Ich finde, dafür trägt jeder eine Eigenverantwortung. Aber wie es dazu gekommen ist, hat schon auch damit zu tun, dass diese Auseinandersetzung nicht stattgefunden hat.
FB Erklärt das den Aufstieg der AfD vor allem in den neuen Bundesländern?
SH Nur bedingt. Es sind ja weniger die Leute, die in dieser Zeit schon gelebt haben, die jetzt so gewählt haben, sondern das sind die viel Jüngeren. Und ich glaube, da geht es eher um so eine Art falsch verstandenen Widerstand. Das Problem liegt darin, dass dieser Begriff umgewertet wurde, gerade in der Corona-Zeit. Dass alles, was nicht dem sogenannten Mainstream entspricht, etwas Cooles hat.
FB Wie kann man diese Menschen zurückholen?
SH Wenn ich das wüsste, wäre ich in der Politik.
FB Dieses Entwertungsgefühl, das auch Ihr Film sehr schön beschreibt, ist das ein Gefühl, das sich von einer Generation auf die andere überträgt oder weitergegeben wird?
SH Ja, ich bin davon überzeugt.
«Ich glaube, dass es unbefriedigend ist, wenn man viel Geld für sich ausgibt.»
FB Wenn Sie es sich aussuchen könnten, gibt es ein Thema, was Sie persönlich umtreibt, das Sie gerne filmisch umsetzen würden?
SH Da gibt es ganz viele Dinge. Und der Dialog findet auch statt. Wir unterhalten uns alle miteinander, wir inspirieren uns gegenseitig. Das bleibt nicht ungehört.
FB Würden Sie sagen, dass Ostthemen, wie sie in Zwei zu eins vorkommen, im deutschen Kino unterrepräsentiert sind?
SH Ich finde, an unserem Film sieht man, dass es in der Hinsicht auf jeden Fall noch ein paar Sachen zu erzählen gibt. Ich würde immer ungern einen Mangel beschreiben, eher das, was man noch machen kann. Je reichhaltiger diese Geschichten werden, je normaler diese Perspektive ist und wird und bleibt, desto besser.
1978 in Thüringen geboren, studierte an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und wurde
ab 1999 in Jena und Leipzig als Theaterschauspielerin tätig. Ihre erste Hauptrolle im Kino besetzte sie in Hans-Christian Schmids Requiem von 2006, für ihre Darstellung wurde Hüller unter anderem mit dem deutschen Filmpreis und dem Silbernen Bären an der Berlinale geehrt. Zahlreiche weitere Preise folgten, auch
für ihre Darbietungen in Toni Erdmann (2016) und In den Gängen (2018) wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Ebenso für Jonathan Glazers The Zone of Interest und Justine Triets Anatomie d’une chute vergangenes Jahr – für ihre Darstellung in Triets Drama wurde Hüller für den Oscar nominiert.