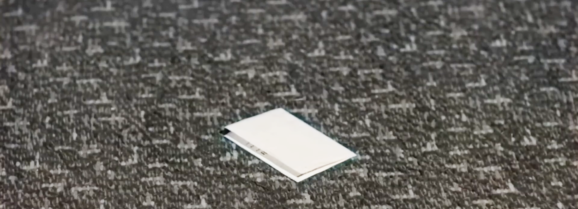Wer ein Körperteil verliert oder amputieren muss, kann an der Stelle des Verlustes eine sogenannte Phantomempfindung oder gar Phantomschmerzen entwickeln. Das Bein, das nicht mehr da ist, der Arm, der fehlt, löst gleichwohl Schmerzen aus, was umso schwieriger zu behandeln ist, da ja das Körperteil, das man kühlen, massieren oder betäuben müsste, gerade nicht mehr vorhanden ist.
Als der österreichische Neurologe und Psychoanalytiker Paul Schilder in den Zwanzigerjahren das Konzept des Körperschemas entwickelt, ist für ihn gerade das Phänomen der Phantomschmerzen ein Beweis dafür, dass unser Körper offenbar nicht nur als physisches Objekt, sondern auch als psychische Vorstellung existiert. Die Hand, die dem realen Körper fehlt, ist im psychisch gespeicherten Körperbild immer noch vorhanden und bereitet gerade durch diesen Widerspruch Schmerzen. Der Phantomschmerz wird hochgradig präsent gerade dadurch, dass es ihm an physischer Materialität fehlt.
Daran musste ich denken, als ich über diesen Film stolperte, ein billiger, unscheinbarer Science-Fiction von 1955 mit dem Titel The Phantom from 10 000 Leagues. Ich hatte mir den Film angeschaut, nicht weil ich wirklich an seiner Geschichte interessiert war, sondern auf der Suche nach Bildmaterial für eines meiner eigenen Videos. Bilder von Uhren und Zifferblättern hatte ich gesucht und auch gefunden. Aber beim eiligen Spulen durch den Film blieben andere vorbeihuschende Bilder in meinem Gedächtnis hängen: ein Schimmer im Meer, ein einsamer Sessel in einem leeren Wohnzimmer, Wasserspuren auf einem Teppich, ein vergessener Zettel in Grossaufnahme – lauter Bilder der Abwesenheit, so wurde mir allmählich klar. Sie beschäftigten mich gerade deswegen, weil ihnen die Bedeutung fehlte.
Ich begann, diese Momente zu sammeln und um sie herum alles wegzuschneiden, worum es bei einem Film normalerweise geht: die Figuren wegschneiden und alle Dialoge, die ganze Story wegschneiden und nicht zuletzt das Phantom, von dem der Filmtitel spricht. Viel blieb dabei nicht übrig; nur noch kleine Bruchstücke, unnütze Reste, Spuren.
Und doch übt die so übriggebliebene Ruine eine grössere Faszination aus als der vollständige Film. Das Phantom aus der Tiefe im ursprünglichen wäre ein lächerlich zusammengeflicktes Monsterkostüm gewesen. Die rätselhaften Bruchstücke meiner Sammlung hingegen liessen ein Phantom erahnen, das sehr viel unheimlicher war.
Die imaginierten Phantomglieder, so schreibt Paul Schilder, sind oftmals gar nicht getreue Abbilder der verlorenen Körperteile, sondern beginnen als Phantome ihre Form zu verändern. Phantomhände sind oft flacher, leichter, hohler oder kürzer, als es die verlorene Hand war. Statt die einstige Realität wiederherzustellen, entsteht Unmögliches: «Phantomglieder folgen ihren eigenen Gesetzen. Wird der Arm in Richtung eines festen Objekts bewegt, geht das Phantomglied in das Objekt hinein. Es kann auch durch den Körper des Patienten selbst hindurchgehen …»
Der Phantomkörper ist mysteriöser, als es der ursprüngliche Körper jemals war. Und so ist auch der filmische Phantomkörper, den ich mir aus den noch vorhandenen Bild-Überresten vorstelle, viel beunruhigender, als es der tatsächliche Filmkörper war.
Vielleicht liegt in dieser Entdeckung auch eine Erklärung dafür, warum uns als Kindern zuweilen gerade jene Filme besonders nahe gingen, von denen wir nur ein kleines Stück gesehen haben, ehe die Eltern uns ins Bett schickten. Bis heute erinnere ich mich an Filmbilder, die ich nur durch den Türspalt erhascht habe. Die Filme machten mir Angst, gerade weil ich ihren ganzen Körper nie sah. Der kleine sichtbare Rest gab Anlass, mir einen fehlenden Filmkörper vorzustellen, wie er nie in Wirklichkeit existieren kann. Das Phantom ist nicht dort, auf dem Bildschirm. Es ist hier, in meinem Kopf, wo ich jenen Film sehe, den es gar nie gab.