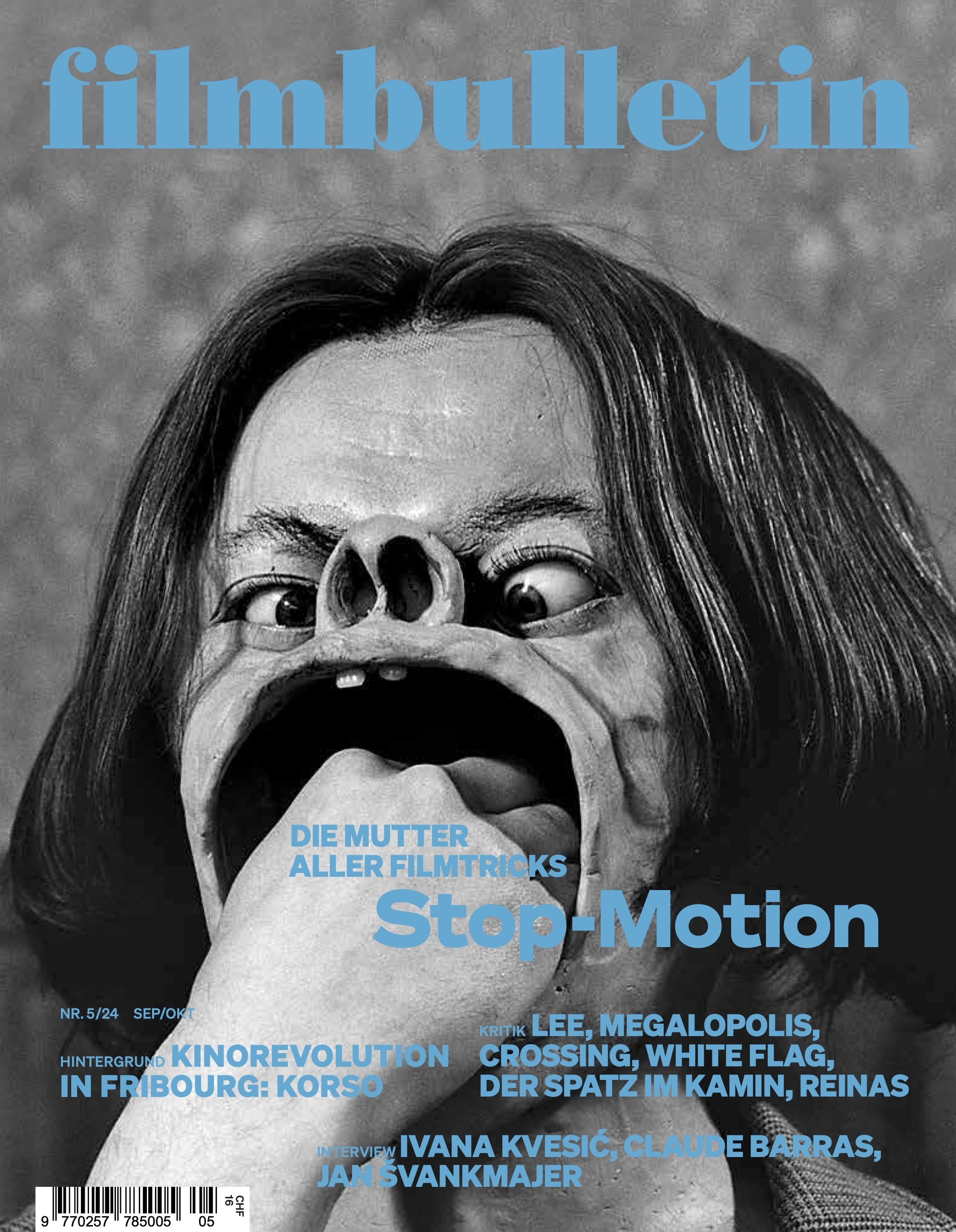Erst spät im Film liest die Hauptfigur Sujo Bücher, in denen es um den freien Willen geht. Der junge Mexikaner wächst in einer Welt auf, in welcher der Verlauf seines Lebens prädestiniert zu sein scheint: Sein Vater, Mitglied eines Drogenkartells, wird ermordet, als Sujo vier Jahre alt ist. Um das Kind vor weiteren Gewaltakten zu schützen, nimmt seine Tante Nemesia es ausserhalb der Kleinstadt versteckt bei sich auf. Nemesia versucht mit Hilfe ihrer Schwester Rosalía, Sujo ihre Werte zu vermitteln und ihn auf einen anderen, gewaltfreien Pfad zu bringen. Eine schier unmögliche Aufgabe: Im ländlichen Michoacán, wo sie wohnen, scheint es nur einen Weg durchs Leben zu geben. Einen, der gezeichnet ist von Gewalt und Drogenhandel.
Der Film erzählt eine fiktive Geschichte, welche vielen realen Biografien in Mexiko entsprungen sein könnte. Eine realitätsnahe Darstellung unterscheidet Hijo de Sicario von anderen Filmen, in denen mexikanische Kartelle vorkommen. Wir sind uns gewohnt, die US-amerikanische Perspektive einzunehmen, in der die Hintergründe der Drogenkartelle häufig vernachlässigt werden. Selbst Werke wie Sicario von Denis Villeneuve oder die Serie Narcos – welche die Komplexität von Kartellen und deren Mitgliedern darzustellen versuchen – bedienen sich an Stereotypen, letztere glorifiziert in einigen Episoden sogar das Kartell-Leben und die damit verbundene Gewalt.

© trigon-film
Anders ist dies bei Hijo de Sicario: Gewalt wird nicht verherrlicht – sie wirkt erschreckend und abschreckend. Der Film hat wenig Interesse daran, die Zuschauer:innen jederzeit erkennen zu lassen, wie Gewalt geschieht oder weshalb sie ihre Opfer trifft. Schreckliches wird stattdessen meist nur angedeutet: Ein abgetrennter Finger, letzte Überreste eines verbrannten Körpers, Schüsse, die nur zu hören sind. Momente wie diese sind im Film geprägt von Gefühlen der Verwirrung und Angst, welche durch die Bindung an die Perspektive Sujos vermittelt werden. Obwohl diese Szenen sporadisch vorkommen, gibt es dennoch stets die leise Angst, den Figuren im Film könnte jederzeit etwas zustossen – ein prägendes Lebensgefühl für viele Menschen in Mexiko. Auch Sprache und Filmsets dürften sich nur unwesentlich von der echten Sprechweise und den Schauplätzen in der Realität unterscheiden. Das Ergebnis ist erstaunlich: ein immersives Filmerlebnis, bei dem man um die Hauptfigur bangt wie deren Tante.
Wie bereits im anderen Film des Regieteams, Sin señas particulares, sind zwei Generationen von Frauen und Kindern vertreten. Erscheinen Männer, bringen sie meist Zerstörung mit sich. Entsprechend zentral ist für den Film der Übergang Sujos von der Kindheit ins Leben als junger Erwachsener. Der Kreislauf der Gewalt scheint fortwährend zu sein, was auch verbildlicht wird: Es gibt wiederkehrende Einstellungen, welche Sujos Geschichte mit derjenigen seines Vaters verbinden.
Dennoch versuchen die Frauen und – nach einer anfänglichen Faszination für die Welt der Kartelle – auch Sujo selbst, ein richtiges Leben im Falschen zu finden. Die zentrale Frage bleibt jene, die Sujo zum Schluss des Films der Dozentin Susan stellt: «Können die Menschen ihr Leben verändern?»